von Bernhard Stengele
Es ist 6.00 Uhr, auf die Sekunde genau 6.00.
Bern, am 26.01. 2012. Ein kleines Hotel, das “Kreuz” heißt: Teppichboden grau, Zentralheizungsluft, aufgehängter Flachbildschirm, Wasser kostet viel Geld, der Manager von Nestle findet das richtig, deshalb sollen auch nur Menschen Wasser kriegen, die es bezahlen können. Aber man kann, glaub ich, das aus dem Hahn trinken. Es trieb mich aus dem Bett hinaus. Zum ersten mal seit Monaten der Impuls wieder zu schreiben von Les Funerailles du desert.
Eigentlich wollte ich ja viel früher, um die Premiere herum am 07.01. Und es hätte ja viel zu berichten gegeben, aber ich konnte nicht, weiß der Geier warum. Jetzt treibt es mich, vielleicht ein letztes Mal. Ich werde hinfliegen zur Dernière, werde diesen Irrsinn auf mich nehmen. Fliege morgen am Freitag, komm am Dienstag zurück. Ich bin froh. Es ist ein gute Entscheidung. Die Produktion hat es verdient, die Darsteller, die mich vermissen. Und ich habe es auch verdient und ich vermisse sie auch, die Darsteller, die Produktion. Ich vermisse Les Funerailles du desert.
Bern in der Schweiz. Vor knapp drei Wochen stand ich auf einer Bühne in Ouaga im Freien unterm Vollmond und habe als Erster Mensch in Westafrika öffentlich das Wort Homosexualität ausgesprochen. Seither ist es kein Tabu mehr. Es ist ausgesprochen, es ist da: ein historischer Moment.
Warum ich? Ich musste einspringen, ein Darsteller war krank. Freust Du dich? hat mich Christa gefragt. Nein, es hat mich nicht gefreut. Als ich dann spielte, habe ich es mehr als gerne getan, ich habe es genossen. Irgendwann, während ich spielte, schaute ich hoch und sah den Vollmond und dachte: merks dir. Eine Woche später schon konnte ich das Erlebnis gut gebrauchen.

Mein erster Auftrag als neue Pfadfinderin des Wanderlust-Blogs ist bestens für den Einstand geeignet: Ich fahre nach Wilhelmshaven, einer Stadt an der Nordseeküste, „am Jadebusen“, wie es in den Touristenbroschüren heißt, eine Stadt, in der ich noch nie war und die auch kein anderer Wanderlust-Blogger erkundet hat. Echte Pionierarbeit also; fehlte nur ein Fähnchen mit dem Wanderlust-Logo im Rucksack, um es auf dem Dach des Stadttheaters in Wilhelmshaven, Hauptquartier der Landesbühne Niedersachsen Nord, aufzupflanzen: erwandert!

Wilhelmshaven, eine kleine Stadt mit 80 000 Einwohnern, steuert man entweder als Tourist zum Baden, Wattwandern und zum Besuch im Marinemuseum an – oder man kommt, weil man bei der Marine arbeitet; sie hat hier den größten Stützpunkt in Deutschland. In Wilhelmshaven wohnen aber auch letzte Zeitzeugen, die 1939 den „Blutsonntag“ im polnischen Bromberg (Bydgoszcz) erlebt haben. Zwei Tage nach Beginn des Polenfeldzugs kam es zu diesem Massaker zwischen Polen und Deutschen, die in Bromberg lebten. Noch immer ist strittig, was die genauen Ursachen waren und wie viele Menschen dabei getötet wurden. Ein großer Teil der deutschen Minderheit, die bis Ende des zweiten Weltkriegs in Bromberg lebte, übersiedelte jedenfalls nach Wilhelmshaven. Heute versucht man, diese finstere Vergangenheit aufzuhellen: Bromberg ist Partnerstadt Wilhelmshavens, und die schon erwähnte Landesbühne Niedersachsen Nord nutzt den Wanderlust-Fonds, um das Thema künstlerisch aufzuarbeiten (weitere Infos): Im Oktober hat das deutsch-polnische Gemeinschaftsstück über den Blutsonntag zuerst in Bromberg (13.10.), dann in Wilhelmshaven (20.10.) Premiere. Dazu dann mehr im Herbst. Momentan nähert man sich gegenseitig mit Gastspielen an: Die Wilhelmshavener haben ihren „Woyzeck“ letztes Jahr in Bromberg gespielt, jetzt haben die Polen ihre „Dreigroschenoper“ in 20 Stunden Busfahrt an die Nordsee gebracht.

Brecht auf polnisch in Deutschland – klingt ungefähr so, als würde man in Polen deutsche Piroggen anbieten. Pawel Lysak, der Intendant des gastierenden Bromberger Stadttheaters „Teatr Polski Bydgoszcz“ und Regisseur der Inszenierung, ist sich des Risikos natürlich bewusst: „In Polen ist die Dreigroschenoper nicht so populär, die Leute finden den Text eher langweilig. Aber hier denken ja alle: ‚Das ist unser Stück und wehe, das wird vermurkst!’“

Der Fatzer-Stoff ist im deutschsprachigen Theater ein Mythos im eigentlichen Sinn. Ein Mythos, weil unentziffert. Es gibt vier- bis fünfhundert Seiten, aber kein Stück. Nicht von Brecht jedenfalls. Es gibt eine Fassung der alten Schaubühne, noch so ein deutscher Mythos. Und es gibt Heiner Müllers Bearbeitung. Müller, Master of Myth, der Herrscher über die Rückprojektion der deutschen Geschichte in die Unerbittlichkeit der Antike. Über Fatzer wird vor allem geraunt: Brechts Schock der Großstadt, als er nach Berlin kam; die Konsequenz des Umsturzes, seine Logik der immer neuen Ausgrenzung; das Verhältnis von Individuum und Kollektiv, das ist der Kern, der die berühmteren Lehrstücke wie „Die Maßnahme“ umtreibt. Ein Mythos bleibt nur so lange Mythos, wie an seiner Interpretation gearbeitet wird und er also unverstanden bleibt. Ich bin nicht sicher, ob das für Heiner Müller zutrifft. Oder auf die Figur Brechts. Sicher aber auf diesen einen Un-Text, das Fatzer-Fragment.
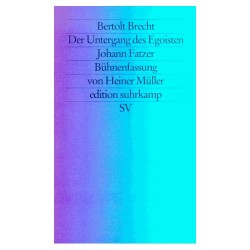
Wer Müllers Fassung liest, hört das ästhetische Familienverhältnis der beiden wichtigsten deutschen Theaterautoren des 20. Jahrhunderts einmal mehr sofort. Der Schrecken des Krieges wird einerseits ein Stück weit gebannt in der Sprache, und doch wieder in ihrer Deutlichkeit abgebildet. Man hört die Drastik dialektisch in der strengen Formalisierung mitzittern. In Pausen, Sprachbildern wie Kirchen, ein Denken und Schreiben, das die Abgeschiedenheit der Emigration – der äußeren bei Brecht, der inneren bei Müller? – vorwegnimmt. Die Geschichte der Deserteure, die aus dem Ersten Weltkrieg flüchten, die Revolution wollen und sogleich wieder scheitern, ist das Gegenteil des Geplauders.
Nun sehen wir aber italienische Schauspieler in der Volksbühne, sie kommen aus Turin, aus dem Teatro Stabile, und zeigen uns „Fatzer Fragment – Getting Lost Faster“ mit deutschen Übertiteln. Und es sieht, trotz einiger angedeuteten Tableaux vivants, die man auch von Müllers Inszenierungen oder mehr noch: von jenen Einar Schleefs kannte, es sieht einfach sehr, sehr anders aus. Wo kein Text mehr hilft, wird improvisiert. Für deutschsprachige Ohren oft: wortreich charmiert. Man gibt sich diesem Sound hin, der die Melodie stärker gewichtet als das Deutsche mit seinen harten Rhythmen, zumal wenn sie im Vers gehalten werden wie bei Brecht/Müller. Das Italienische wirbt um den Hörer, um das Deutsche muss man als Hörer selbst werben. Das ist eine ungewöhnliche, im Sinne der Unterbrechung des Bekannten, des vermeintlich Verstandenen auch: eine sinnliche Erfahrung. Die Revolution als Casting Show mit dem Publikum, die Musik als oft romantisches Elektro-Intermezzo: Der Text, und es ist viel Text, erscheint so nicht als Evangelium, sondern als Projektion. Für Müller war es die RAF. Für die Turiner sind es die kommenden Aufstände unserer Zeit. Dass man zwischen diesen Klängen und Improvisationen auch immer wieder den Text nach dem Buchstaben zu spielen versucht und auf dieser großen, Brecht- wie Müller-gestählten Bühne nur schwerlich durchdringt, ist am Ende vielleicht nebensächlich.


VOLKSBÜHNE italienisch beflaggt! Berliner und Turiner Theatermacher treffen sich zum FATZER MATERIALLAGER 19. bis 21. Januar 2012
Seit Ende November laufen die Proben in Turin zur italienischen Uraufführung des Fatzer-Fragments von Brecht. Es sind sehr intensive Tage – Tage, wo das sich-am-Text-Erproben über die Probezeit hinaus geht. Das lässt sich wahrscheinlich immer mehr oder weniger erfahren, wenn man an einer Inszenierung arbeitet, wie bei jeder kollektiven Arbeit, wo der Einsatz vieler Intelligenzen und Wahrnehmungsweisen tatsächlich erforderlich wird. Sinnvoller Zufall: Wir machen Theater in einer stillgelegten Fabrik. Nach einer Woche im Teatro Stabile im Turiner Zentrum, proben wir seit Anfang Dezember in der Fonderie-Limone in Moncalieri, in der südöstlichen industriellen Peripherie von Turin. Diese Außenstelle, die das Teatro Stabile aus einer ehemaligen, vor dem ersten Krieg stammenden Gießerei bekommen hat, ist mit ihren sanierten Fabrikanlagen, Hochöfen und Schlafkasernen unser Mülheim geworden: Das Loch, aus dem Fatzer aus dem ersten Weltkrieg, der unsere Zeiten eingeleitet hat, in die Gegenwart herauszukriechen versucht.
Die ersten Tage sind die der kollektiven Begegnung mit den Worten gewesen. Es war eher ein Zusammenstoß, ein Eisenbahnunglück, zu dem man sich verabredet hatte. Trotz seiner erarbeiteten Einfachheit ist es einer der schwierigsten Texte, wie die Schauspieler und Mitarbeiter gestehen müssen, mit denen sie sich jemals auseinandergesetzt haben. Natürlich kommt alles Wissen und Verstehen, das man beim ersten individuellen Lesen und Überlegen gesammelt zu haben schien, wie üblich durcheinander. Mit einem aber diesmal vielleicht merkwürdigen Gefühl: als gehe man durch das Trümmerfeld und die Wüste des eigenen lückenhaften Wissens und unterbrochenen Verstehens herum, nur der Text bleibt in seiner fragmentarischen Perfektion erhalten, bei jedem Rundgang, bei jeder Invasion weniger fremd aber gleich fern. Wir merken bald, es geht nicht so sehr darum, den Text zu „verstehen“, sondern darum die Orte unserer „Wirklichkeit“ zu finden, die der Text am meisten verklärt. Wo versteht uns Fatzer besser, als wir uns selbst verstehen. Wir haben den erschreckenden Eindruck, wie viel und wie fachkundig man heute wissen und verstehen müsste, um auf das Leck in den fachkundigen Darstellungen der „Wirklichkeit“ auch nur hinweisen zu können (selbst wenn es nur um Theater geht).
Eines Abends beim Autofahren von Turin nach unserem „Mülheim“ zurück, erzählt der Rundfunk von der Katastrophe in den genauesten, selbstreferenziellsten, technisch-ökonomischen Wörtern und über die globalisierte Protestbewegung in den begeisterndsten und selbstgenügsamsten Slogans. Wir sitzen von langen Proben und Versuchen ermüdet eng, hungrig und erkältet im Auto und haben keine Lust, keine Energie mehr, auch nur den Kanal zu wechseln. Nur Werner, einer unserer Fatzer-Masken, der in seinem deutsch-muttersprachlichen und überlegenden Ton sich fremd genug anhört, als ob er uns auch aus einer anderen Zeit redete, bemerkt leise vor sich hin: „tutti parlano a cazzo di tutto“. „Man schwatzt überall Scheiße über alles“.
(Milena Massalongo)
Milena Massalongo ist als Dramaturgin für das Teatro Stabile di Torino, dem Partnertheater der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin, in der Inszenierung “Fatzer Fragment / Getting lost faster” (Regie: Fabrizio Arcuri) tätig. Das Projekt wird am 20. Januar 2012 in der Volksbühne erstaufgeführt. Von Milena Massalongo stammt außerdem die erste italienische Übersetzung von Brecht/Müller “Der Untergang des Egoisten Fatzer”.
www.volksbuehne-berlin.de





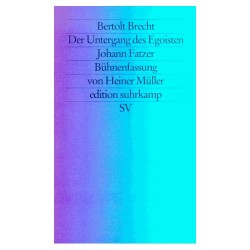



 Pfadfinder
Pfadfinder Spotlight
Spotlight

