Fatzer ist über die Alpen gegangen. Nach den Fatzer-Festspielen in Berlin, ist Brechts von Widersprüchen nicht nur besoffene, sondern bis in die Form verwundete Fragment über vier Kriegsdeserteure in Turin angekommen. Für das Teatro Stabile, kein kleines Theater, ist dieser Austausch wichtiger als für die Volksbühne in Berlin, das kriegt man vor Ort sofort vermittelt. Man giert nach Austausch. In Italien sind die Theater angewiesen auf kleine Tourneen, sonst sind die Produktionen manchmal nach zwei Aufführungen schon weg. Und der Ruf der Volksbühne reicht mindestens bis nach Turin, besonders jener von Frank Castorf (den man in Berlin leider nicht zu Gesicht bekommen habe, sagen manche der überaus höflichen Italiener). Und auch wenn man das in den in den unter Druck geratenen Schauspielhäusern nicht gerne hört: Die Verhältnisse, um anspruchsvolles Theater zu machen und darüber nachzudenken, sind in Deutschland einmalig. Soweit der materialistische Kunstrahmen für die Fatzer-Begeisterung der Torinesi.

Nicht jeder Grund für die Turiner Fatzeriade leuchtet sofort ein, wenn man als Tourist, noch benommen vom sonnigen Alpenflug, im verschneiten Turin eincheckt. Der Stein, der Marmor, die Boulevards, die Plätze, diese ganze unzerstörte Baumasse der letzten zweihundert Jahre, und immer wieder: die nahen Alpen. Turin erscheint reich und schön und auf den Straßen gibt es überall Bücher zu kaufen. Was will man da mit diesem Brecht, der im Fatzer wie der Teufel ringt mit der Dynamik von Individuum und Gemeinschaft wie später nie mehr so deutlich, so experimentell, so unfertig, so verzweifelt?

Der Fatzer-Stoff ist im deutschsprachigen Theater ein Mythos im eigentlichen Sinn. Ein Mythos, weil unentziffert. Es gibt vier- bis fünfhundert Seiten, aber kein Stück. Nicht von Brecht jedenfalls. Es gibt eine Fassung der alten Schaubühne, noch so ein deutscher Mythos. Und es gibt Heiner Müllers Bearbeitung. Müller, Master of Myth, der Herrscher über die Rückprojektion der deutschen Geschichte in die Unerbittlichkeit der Antike. Über Fatzer wird vor allem geraunt: Brechts Schock der Großstadt, als er nach Berlin kam; die Konsequenz des Umsturzes, seine Logik der immer neuen Ausgrenzung; das Verhältnis von Individuum und Kollektiv, das ist der Kern, der die berühmteren Lehrstücke wie „Die Maßnahme“ umtreibt. Ein Mythos bleibt nur so lange Mythos, wie an seiner Interpretation gearbeitet wird und er also unverstanden bleibt. Ich bin nicht sicher, ob das für Heiner Müller zutrifft. Oder auf die Figur Brechts. Sicher aber auf diesen einen Un-Text, das Fatzer-Fragment.
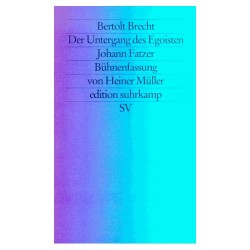
Wer Müllers Fassung liest, hört das ästhetische Familienverhältnis der beiden wichtigsten deutschen Theaterautoren des 20. Jahrhunderts einmal mehr sofort. Der Schrecken des Krieges wird einerseits ein Stück weit gebannt in der Sprache, und doch wieder in ihrer Deutlichkeit abgebildet. Man hört die Drastik dialektisch in der strengen Formalisierung mitzittern. In Pausen, Sprachbildern wie Kirchen, ein Denken und Schreiben, das die Abgeschiedenheit der Emigration – der äußeren bei Brecht, der inneren bei Müller? – vorwegnimmt. Die Geschichte der Deserteure, die aus dem Ersten Weltkrieg flüchten, die Revolution wollen und sogleich wieder scheitern, ist das Gegenteil des Geplauders.
Nun sehen wir aber italienische Schauspieler in der Volksbühne, sie kommen aus Turin, aus dem Teatro Stabile, und zeigen uns „Fatzer Fragment – Getting Lost Faster“ mit deutschen Übertiteln. Und es sieht, trotz einiger angedeuteten Tableaux vivants, die man auch von Müllers Inszenierungen oder mehr noch: von jenen Einar Schleefs kannte, es sieht einfach sehr, sehr anders aus. Wo kein Text mehr hilft, wird improvisiert. Für deutschsprachige Ohren oft: wortreich charmiert. Man gibt sich diesem Sound hin, der die Melodie stärker gewichtet als das Deutsche mit seinen harten Rhythmen, zumal wenn sie im Vers gehalten werden wie bei Brecht/Müller. Das Italienische wirbt um den Hörer, um das Deutsche muss man als Hörer selbst werben. Das ist eine ungewöhnliche, im Sinne der Unterbrechung des Bekannten, des vermeintlich Verstandenen auch: eine sinnliche Erfahrung. Die Revolution als Casting Show mit dem Publikum, die Musik als oft romantisches Elektro-Intermezzo: Der Text, und es ist viel Text, erscheint so nicht als Evangelium, sondern als Projektion. Für Müller war es die RAF. Für die Turiner sind es die kommenden Aufstände unserer Zeit. Dass man zwischen diesen Klängen und Improvisationen auch immer wieder den Text nach dem Buchstaben zu spielen versucht und auf dieser großen, Brecht- wie Müller-gestählten Bühne nur schwerlich durchdringt, ist am Ende vielleicht nebensächlich.

Was wir hier auf diesem Blog betreiben, ist keine Theaterkritik. Allenfalls Theaterjournalismus. Aber selbst das ließe sich aus traditioneller Warte bezweifeln. Wir haben den gleichen Auftraggeber wie die Produktionen, die wir begleiten. Wir sind alles amtierende oder ehemalige Theaterkritiker oder irgendwas dazwischen und probieren hier etwas, was auf dem freien Markt „corporate publishing“ heißen würde. Die Theaterkritik der Tagezeitungen schwankt derweil zwischen Phantom und Farce. Zwischen Geisterstunde und der Simulation einer Öffentlichkeit, die es so nicht mehr gibt. Dieses Blog ist nicht zuletzt ein Mittel, solche Veränderungen zu reflektieren. Und dies nicht nur aus Sicht des, nun ja: Kritikers, sonder auch aus jener der koproduzierenden Theater.
Bevor man über neue Möglichkeiten des Gesprächs über Theater nachdenkt, sollte man den Fakten kurz ins Auge schauen. In Deutschland arbeiten rund 17.000 Journalisten, davon schreiben mittlerweile noch zwischen 3 und 5 ausschließlich und in Festanstellung über Theater – ein paar wenige mehr, wenn wir Wochen- und Fachblätter dazu zählen. Wir reden so oder so über die zweite Stelle nach dem Komma. Wir könnten uns in kleinteiligen Diskussionen verlieren, ob ein Radiogespräch eine kritische Textsorte sei oder eine Vorschau nicht auch Öffentlichkeit herstelle. Oder wir könnten die Theaterkritik noch zehn Jahre schlussverwalten. Aber wir sollten nicht mehr so tun, als sei dieser Beruf noch ein Beruf.

Martin Zongo vom C.I.T.O-Theater ist gerade aus Burkina Faso angereist, trägt elegante Schuhe und beantwortet im Foyer des Mainfranken Theater in Würzburg geduldig Fragen, als hätte er das schon immer gemacht. Eigentlich wäre schon Mittagszeit an diesem sonnigen Novembersonntag. Aber es dauert alles etwas länger – die Übersetzungen zwischen Deutsch und Französisch, die familiäre Atmosphäre zwischen Würzburger Abonnenten, ihrem Schauspielchef Bernhard Stengele und den Burkinabé. Man hat Zeit und Interesse. Ja, sagt Zongo, es gebe auch in Ouagadougu Sprechtheater. Aber nur da, und ohne festes Haus. Am Abend sitze ich in der Nähe von Zongo, als auch er die Zusammenarbeit „Les Funérailles du désert“ zum ersten Mal sieht (s. Blogeintrag unten). Er schaut auf diese riesige Bühne und findet kaum Worte für die schiere Dimension.

Teil des interplanetaren Foyers in Würzburg
Tagsüber hat man viel geredet, erklärt, kontextualisiert. „Theater machen in West-Afrika“ war ein Begleit-Symposium zu „Les Funérailles du désert“ am 13.11., von 10 bis 17 Uhr gab es einen Überblick über die gesamte westafrikanische Theaterregion, einen Fokus auf Burkina Faso, man erfuhr Einführendes über die Säulenheiligen der Postcolonial Studies, Frantz Fanon und Homi Bhabha. Es gab einen Vergleichsbericht von den Konstanzern, die gerade mit Malawi zusammenarbeiten und im Juni 2012 Premiere haben (wir werden berichten!), und man hörte ganz viele Schmankerl zu Würzburg-Ouagadougou. Das Publikum mischte sich zunehmend stärker ein. So sehr diese kleine Tagung durchdacht war und die Theatergänger behutsam begleiten wollte auf dem Weg zur Begegnung mit dem, je nun, Fremden: In der Begegnung mit dem vermeintlich Eigenen, den Zuschauern nämlich, erfährt man mindestens so gut, warum man sich die viele Arbeit immer wieder machen muss.

Es ist ein Sonntagabend, Berlusconi hat seinen Rücktritt erklärt, der „Polizeiruf 110“ mit einer sehr schwangeren Kommissarin ist gerade vorbei. Und als ich auf dem Weg zum Bahnhof Würzburg in eine leere Kneipe schaue, steht da auch schon Günter Jauch und leitet betroffen eine Runde über rechten Terror ein, während die Republik vor dem Schirm langsam wegdämmert. Ich bin zweihundert Schritte vom Mainfranken Theater entfernt, wo das Publikum wahrscheinlich noch immer steht und jubelt. Die Premiere von „Les funérailles du désert“ ist schon einen Monat her, aber der große Saal war annähernd voll. Max de Nil, mit 61 Jahren wohl ältestes Ensemblemitglied, deklamiert kurz vor Schluss: „Wir sind alle aus Afrika“, die acht Schauspieler vom C.I.T.O.-Theater in Ouagadougou in Burkina Faso und die sieben deutschen gehen in ein afrikanisches Lied über. Blende. Cut. Begeisterung. Was ist hier geschehen?

Es gibt, unmittelbar danach, zwei Erklärungen. Zum einen, nennen wir das Kind beim Namen: Kitsch. Jedes Musical und immerhin die Hälfte des Kanons der deutschen Klassik kennt Kitschmomente. Faust, Kabale und Liebe, Käthchen. Wir haben mehr als zwei Stunden interkulturelles Theater gesehen, eine Begegnung zwischen Würzburg und Ouagadougu. Und das war mehr oder weniger auch das Thema dieser 140 Minuten. Zum andern: Vielleicht war das mehr Komödie, als man zuerst dachte, und die Komödie ist die Gattung, die vom Gelingen ausgeht. Zwar endet eine der größten Tragödiendichtungen aller Zeiten ebenso versöhnlich, aber die „Orestie“ von Aischylos zeigt in den zwei ersten der insgesamt drei Teile derart viel Gewalt, dass es am Ende ohne Vergessen nicht geht. Gut, man muss auf dem Boden eines ICE bleiben: Dieses Stück hat nichts mit Goethe, Schiller, Kleist und auch nichts mit Aischylos zu tun, was seine Literarizität angeht. Aber im Kern geht es um, wenn man möchte, Gewaltvermeidung. Die kulturelle Differenz – Wirtschaft, Wetter, Politik – ist selbst in diesem auf Austausch ausgerichteten Theaterprojekt so unüberwindbar, dass man gar nicht anders kann, als nach Ähnlichkeiten zu suchen. Zumindest in einem ersten Schritt, bei einer ersten künstlerischen Begegnung. Der Abend will die Nestwärme im Fremden finden, also Angst abbauen. Kann sein, dass diese Erklärung selbst Kitsch ist.


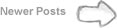


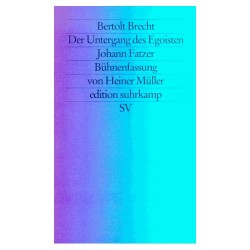




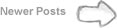
 Pfadfinder
Pfadfinder Spotlight
Spotlight

