Ob ich die Inszenierung denn als typisch finnisch empfunden habe, fragt mich die Produktionsleiterin Eeva Bergroth nach der Uraufführung von Kristian Smeds’ erster Arbeit an den Münchner Kammerspielen. Nehme ich all meine Finnland-Klischees zusammen muss ich sagen: Aber ja! Ganz oberflächlich: der Vodka, die Sauna, der Schnee. Darunter: das Schwere, Harte, die Kraft, die düstere Melancholie und raue Lebenslust. Ein deutscher Regisseur könnte wohl nie so ausschließlich aus dem Bauch heraus inszenieren. „Der imaginäre sibirische Zirkus des Rodion Raskolnikow“ heißt der Abend, Pate stand Dostojewskis Kriminalroman „Verbrechen und Strafe“ – mehr als Grundmotive sind aber nicht übrig geblieben vom 800-Seiten-Klassiker.
Der Finne Smeds lädt uns ein zu einer Zirkusvorstellung: Die Spielhalle ist die Manege, wir sitzen an drei Seiten um diese schäbige Kulisse, die vierte bedeckt ein abgenutzter roter Vorhang, gesäumt von Totenkopf-Matroschkas. Über uns ein grünes Tuch, ein Zelt imitierend. Der Geruch von Sägespänen und Pferdeschweiß steigt mir in die Nase, aber das muss Einbildung sein.

Es beginnt spielerisch und leicht: Der Musiker am Rand (Timo Kämäräinen) beginnt auf der Gitarre zu spielen und André Jung vom Kammerspiel-Ensemble tritt mit abgewetztem Zylinder, roter Uniform und Clownsgesicht als Direktor auf, formt aus Steinen einen Kreis, bespritzt ihn mit Vodka – fertig ist der Pool oder das Eisloch, je nachdem. Zwei finnische Schauspieler und der deutsche Kammerspiel-Kollege Edmund Telgenkämper geben die Zirkus-Crew: trauriger Pierrot, lustiger rotnasiger Clown und Draufgänger-Artist. Sie ziehen sich pantomimisch aus, schrecken zurück vor dem kalten Wasser, springen kopfüber hinein, prusten, japsen. Das ist schön und lustig und poetisch. Härter dann nur Augenblicke später: Der Artist kollabiert im Wasser, seine Kollegen spritzen Rasierschaum in seinen Hintern, pfuschen mit der Rasierklinge an seinen Schamhaaren herum – und tiefer. Spiel und Folter zugleich ist das, mitlachen, auslachen, totlachen.

Was Lage und Landschaft betrifft, müssten sich die russischen Schauspieler aus Saratow am Theater Junge Generation (tjg) in Dresden eigentlich wie zu Hause fühlen: Direkt hinterm Haus in Dresden-Cotta fließt die Elbe entlang – ähnlich breit und ruhig wie die Wolga, die durch Saratow fließt, nur einen Katzensprung vom Kinder- und Jugendtheater Kisseljow entfernt (hier mein Reisebericht aus Saratow). Das ist aber, zugegeben, wohl die einzige Gemeinsamkeit der beiden Kindertheater. Es sind eher die Unterschiede im Temperament, im Spiel, in der Theatertradition, die deutsche und russische Schauspieler gleichermaßen füreinander „entflammt“ haben, wie es die Dramaturgin Dagmar Domrös ausdrückt. Auch Ania Michaelis, die Regisseurin der koproduzierten Inszenierungen, meint, die vier russischen Gäste und die vier deutschen Schauspieler hätten „viel aneinander gelernt“ und seien nun „schwer verliebt ineinander“. Die Völkerverständigung war also erfolgreich – und das ist gar nicht so erwartbar, wenn keiner ein Wort in der Sprache des anderen spricht.

Das tjg in Dresden

Das Kisseljow-Theater in Saratow
.
.
.
.
.
.
.
Was genau die beiden Theatersprachen unterscheidet, wurde den Zuschauern nun am tjg exemplarisch vorgeführt – eine Lehrstunde für jeden, den die Entstehungsprozesse am Theater faszinieren: Im Anschluss an die Premiere der deutschen Fassung von „Und über uns leuchten die Sterne…“ mit dem tjg-Ensemble folgte das russische Original, einen Tag später mischten sich die Schauspieler zu zwei deutsch-russischen Versionen. Vier mal hintereinander also das gleiche Stück – immer mit ganz unterschiedlicher Energie, das ist das Spannende daran.

Eines zeichnet das Team des Dresdner Staatsschauspiels wirklich aus: Es geht erfrischend offen mit Erfolgen und Misserfolgen um. Christian Lollike, der Dramatiker, den Armin Petras vor einigen Jahren als den „dänischen Schlingensief“ bezeichnete und der dort gerade ein Stück über den Terroristen Breivik auf die Bühne bringt, sollte im Zuge der Kooperation mit dem Königlichen Theater Kopenhagen eigentlich mit seinem in Dresden recherchierten Stück „Der Schacht“ uraufgeführt werden. Es beschreibt „den Gang dreier Touristen durch Dresden und ihre Konfrontation mit Ressentiments, Geschichtsverklärung und gebrochenem Idyll“, wie Chefdramaturg Robert Koall es zusammenfasst. Ein Stück also, dass sich ganz im Sinne des Wanderlust-Konzepts tatsächlich mit Dresden auseinandersetzt – ganz aus dem Blick eines Fremden, der am Ende seiner Recherchereise ein Stück produziert haben soll.
„Wir haben lange über den Text diskutiert“, sagt Koall, „und beschlossen, ihn als Lesung zu präsentieren.“ In einer Stadt wie Dresden, die sich so intensiv mit sich, ihrer Identität und ihrer Vergangenheit beschäftigt, würde jedes Stück untergehen, das mit nichts als mit einem unbefangenen Blick auf die Stadt schaut, meinen Koall und sein Intendant Wilfried Schulz. Das wäre nicht auf der Höhe der Dresdner Diskussionen.
Schon hier stellen sich Grundsatzfragen: Wie ergiebig ist es denn wirklich unter künstlerischen Gesichtspunkten, einen Autor für relativ kurze Zeit auf internationale Recherchereise zu schicken? Wie gut kann sich ein „Neuling“ unter lauter „Experten“ an der Stadtgeschichte abarbeiten? Im besten Fall deckt er blinde Flecken auf, im Normalfall kommt er über Klischees kaum hinaus. Umsonst hat Lollike seinen Dresden-Rundgang aber nicht geschrieben: Die Kopenhagener sind vom Stück angetan und wollen es nun bei sich auf den Spielplan setzen.
Ein Glück für Dresden aber, dass Christian Lollike zeitgleich, also im weitesten Sinne noch unter Elb-Einfluss, ein zweites Stück schrieb, das sich umfassender mit der heutigen Lebenswirklichkeit beschäftigt: „Das normale Leben oder Körper und Kampfplatz“ erlebte nun im Kleinen Haus seine Uraufführung, inszeniert vom 28jährigen Regiedebütanten Hauke Meyer. Koall, der Dramaturg der Produktion, beschreibt das Stück im Programmheft als „Gesellschaftsanalyse, die über Dresden weit hinausweist“. Es handle von der Verlorenheit des Einzelnen in einer Welt, deren Anforderungen und Zumutungen seine Kräfte übersteigen. Am Versuch, das „normale Leben“ zu schildern, scheitern die Figuren A, B und C. Wo immer sie beginnen, beim Berufsalltag, bei der Kindererziehung oder der Partnerschaft – letztlich endet jeder Erzählversuch in Wahn, Paranoia, Leistungsversessenheit, Burn-Out oder Depression. Lollikes Figuren sind nicht psychologisch verortet, sie sind eher postdramatische Denkmuster, Systeme, Theorien. Der Autor lässt sie an der „Inneren Stasi“ zugrunde gehen, einem Kontrollsystem, das als eine innere Überwachungskamera beschrieben wird. Man könnte es auch, gut psychoanalytisch, ein Über-Ich nennen – der Begriff „Innere Stasi“ verweist aber neben den psychologischen auch auf die gesellschaftlichen Ursachen des inneren Wahns. Lollike führt die Selbstkontrolle als unser einzig verbliebenes Machtinstrument vor, als Freiheit zur Unfreiheit: Wer nicht mal seinen eigenen Körper kontrollieren kann, was soll er dann unter Kontrolle haben? Wie soll man jemandem vertrauen, der nicht einmal bei einem Stück Kuchen standhaft bleibt?

‘’We stay when the others leave’’, is a line quoted from one of the lady Africans working in a German NGO Office, in the play World 3.0: The Aid Machinery. In the scene, the young lady explains or rather complains how she does the same kind of work that her European colleague does, but gets half the European salary.
But The Aid Machinery is not a play about how people of different races work and get paid in different offices and organizations. It is a play about the conflicts that arise between African and European communities on the basis of Development Aid. It focuses more on how funds get misused and how a lot of people get negatively affected by it.
In the play, an African village is given money to help construct a powerhouse which will help generate electricity for the whole village. It is the coming of this money that cause a lot of conflicts because of the people that the NGO must first please with the money, in order to freely work on the project, which in the end does not help constructing the powerhouse.
The Aid Machinery, a nine cast play, directed by Clemens Bechtel and Thokozani Kapiri had its premier on the 8th of June, after having eight weeks of rehearsal. It is a play that brought together different funders of both Theatre and Development Aid to come and witness the reality of Development Aid.
(O’tooli Masanza)
Im russischen Kisseljow-Jugendtheater wimmelt es von Superlativen: Nach der ältesten Inszenierung (64 Jahre) am ältesten Kinder- und Jugendtheater der Welt (94 Jahre) sehe ich heute die kürzeste Aufführung (40 Minuten) für die jüngsten Zuschauer (ab 2 Jahre) – es ist das Kooperationsprojekt „…und über uns leuchten die Sterne…“, gemeinsam erarbeitet mit dem Theater Junge Generation (tjg) in Dresden.
Ania Michaelis, Regisseurin und Oberspielleiterin des tjg, hat dafür als zentralen Punkt den Moment vor dem Einschlafen eines Kindes gewählt, wenn sich im Kinderzimmer aus Schatten Monster formen, Geräusche plötzlich lauter, anders klingen, die Lichter von der Straße Zeichen zu senden scheinen und die lachenden Eltern im Wohnzimmer einer anderen Welt angehören. Es ist der Moment der Trennung, an den Kleinkinder sich allabendlich gewöhnen müssen und der mehr bedeutet als nur die Augen zu schließen. „Jeder von uns wird allein einschlafen und wir sind glücklich, wenn wir angelächelt werden vor jedem Abschied“, beschreibt es Michaelis in ihrem „poetischen Konzept“. „Dann erst gleiten wir ins Licht der Nacht, in die Einsamkeit unserer Körper, in einen Traum.“ Es ist zum einen ein universelles Thema, zum anderen eines, das ohne Sprache, aber mit vielen Bildern, Symbolen, Lauten erzählt werden kann – gut gewählt also für eine russisch-deutsche Koproduktion.


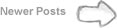





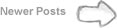
 Pfadfinder
Pfadfinder Spotlight
Spotlight

