„Die Wahrheit liegt auf dem Platz” zitierte Lutz Hübner einmal Otto Rehagel, als ich ihn nach seinem Verhältnis zum Publikum fragte. Soll für den Dramatiker heißen: Das beste Stück hat sein Ziel verfehlt, wenn die Leute es nicht sehen wollen. Für keine andere Kunst ist das Publikum so wichtig wie für die Bühne. Literatur lebt vom einsamen Rückzug des Lesers; auch ein Gemälde verlangt nicht nach einem Saal von Betrachtern zur gleichen Zeit, selbst einen Film kann man sich (zur Not) allein auf der Couch anschauen, ohne dass den Film das tangierte. Theater aber findet ohne Publikum schlicht nicht statt. Und: Ein Bühnenkunstwerk verändert sich mit dem Publikum. Nicht das Was, aber das Wie des Geschehens ist beeinflussbar von der Reaktion der Zuschauer – jeder Schauspieler kann ein Lied davon singen, wie sich die Präsenz einer schweigenden Wand oder lachenden Menge auf die Stimmung auswirkt, wie eine konzentrierte oder gelangweilte Audienz. Die Wahrheit, sie liegt fürs Theater also im Parkett.
Dort sitzt „das Publikum“ – und das Wort klingt, als handle es sich um eine homogene Masse. Dabei kann diese Zwangsgemeinschaft eines Abends leicht vom Einzelnen sabotiert werden: Ein Hüsteln an einer heiklen Stelle, ja, ein einziger unzufriedener Zuschauer kann mit Buh-Rufen im Schlussapplaus die Stimmung kippen lassen. Theater, das ist eben auch Dialog zwischen Künstler und Zuschauer – wenn der eine am anderen vorbei redet, fällt die Kunst in den Graben.
Was für eine Macht sie haben, diese Menschen im Zuschauerraum! Und doch, es ist paradox: Das Publikum ist zwar die wichtigste Instanz, gleichzeitig hat sie aber nichts zu melden. Nirgendwo, so scheint es, ist das Verhältnis zwischen Kunstbetrieb und Rezipient so ambivalent wie im Theater. Wie im deutschen Theater, muss man wohl hinzufügen. In keinem anderen Land kann es sich der Bühnenbetrieb erlauben, seinen avantgardistischen Kunstanspruch noch immer so zu behaupten wie in der (trotz aller Sparzwänge) gut subventionierten deutschen Theaterlandschaft. Ist das nun Bevormundung des Publikums? Oder unerlässliche ästhetische Erziehung? Wie auch immer man es finden mag, man braucht diese Errungenschaft nicht so unbedacht abzusetzen, wie sich das die Autoren des „Kulturinfarkts“ wünschen. Oder ist wichtige, bahnbrechende Kunst jemals aus demokratischen Entscheidungen hervorgegangen?
Meine Eindrücke von Theaterbesuchen im Ausland kann man zwar nur oberflächlich nennen: In London kürzlich fiel mir der leicht konsumierbare Fernsehrealismus auf, in Russland die schwergewichtige Tradition. Klischees natürlich, über die es bei kurzen Reisen kaum je hinausgeht. Trotzdem: Die Freiheit zum Experimentieren scheint doch am meisten im deutschen Theater zuhause – gerade weil es nicht zu hundert Prozent von verkauften Eintrittskarten abhängig ist. Einerseits.

Der Fatzer-Stoff ist im deutschsprachigen Theater ein Mythos im eigentlichen Sinn. Ein Mythos, weil unentziffert. Es gibt vier- bis fünfhundert Seiten, aber kein Stück. Nicht von Brecht jedenfalls. Es gibt eine Fassung der alten Schaubühne, noch so ein deutscher Mythos. Und es gibt Heiner Müllers Bearbeitung. Müller, Master of Myth, der Herrscher über die Rückprojektion der deutschen Geschichte in die Unerbittlichkeit der Antike. Über Fatzer wird vor allem geraunt: Brechts Schock der Großstadt, als er nach Berlin kam; die Konsequenz des Umsturzes, seine Logik der immer neuen Ausgrenzung; das Verhältnis von Individuum und Kollektiv, das ist der Kern, der die berühmteren Lehrstücke wie „Die Maßnahme“ umtreibt. Ein Mythos bleibt nur so lange Mythos, wie an seiner Interpretation gearbeitet wird und er also unverstanden bleibt. Ich bin nicht sicher, ob das für Heiner Müller zutrifft. Oder auf die Figur Brechts. Sicher aber auf diesen einen Un-Text, das Fatzer-Fragment.
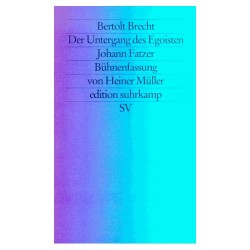
Wer Müllers Fassung liest, hört das ästhetische Familienverhältnis der beiden wichtigsten deutschen Theaterautoren des 20. Jahrhunderts einmal mehr sofort. Der Schrecken des Krieges wird einerseits ein Stück weit gebannt in der Sprache, und doch wieder in ihrer Deutlichkeit abgebildet. Man hört die Drastik dialektisch in der strengen Formalisierung mitzittern. In Pausen, Sprachbildern wie Kirchen, ein Denken und Schreiben, das die Abgeschiedenheit der Emigration – der äußeren bei Brecht, der inneren bei Müller? – vorwegnimmt. Die Geschichte der Deserteure, die aus dem Ersten Weltkrieg flüchten, die Revolution wollen und sogleich wieder scheitern, ist das Gegenteil des Geplauders.
Nun sehen wir aber italienische Schauspieler in der Volksbühne, sie kommen aus Turin, aus dem Teatro Stabile, und zeigen uns „Fatzer Fragment – Getting Lost Faster“ mit deutschen Übertiteln. Und es sieht, trotz einiger angedeuteten Tableaux vivants, die man auch von Müllers Inszenierungen oder mehr noch: von jenen Einar Schleefs kannte, es sieht einfach sehr, sehr anders aus. Wo kein Text mehr hilft, wird improvisiert. Für deutschsprachige Ohren oft: wortreich charmiert. Man gibt sich diesem Sound hin, der die Melodie stärker gewichtet als das Deutsche mit seinen harten Rhythmen, zumal wenn sie im Vers gehalten werden wie bei Brecht/Müller. Das Italienische wirbt um den Hörer, um das Deutsche muss man als Hörer selbst werben. Das ist eine ungewöhnliche, im Sinne der Unterbrechung des Bekannten, des vermeintlich Verstandenen auch: eine sinnliche Erfahrung. Die Revolution als Casting Show mit dem Publikum, die Musik als oft romantisches Elektro-Intermezzo: Der Text, und es ist viel Text, erscheint so nicht als Evangelium, sondern als Projektion. Für Müller war es die RAF. Für die Turiner sind es die kommenden Aufstände unserer Zeit. Dass man zwischen diesen Klängen und Improvisationen auch immer wieder den Text nach dem Buchstaben zu spielen versucht und auf dieser großen, Brecht- wie Müller-gestählten Bühne nur schwerlich durchdringt, ist am Ende vielleicht nebensächlich.



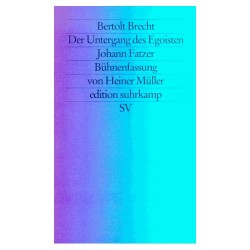
 Pfadfinder
Pfadfinder Spotlight
Spotlight

